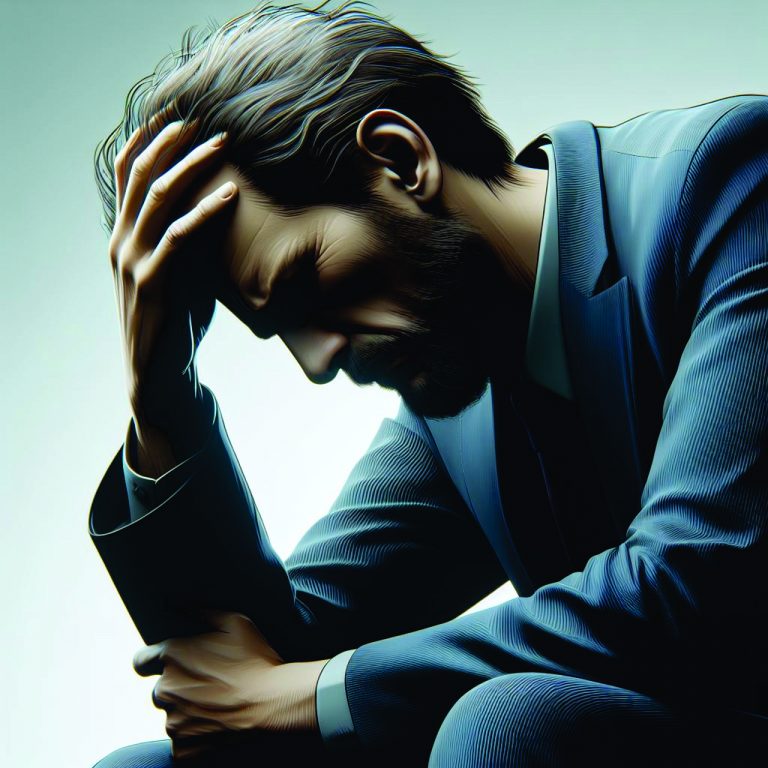Demut – Was wir alle dringend wieder brauchen!
Demut klingt altmodisch, fast nach Weihrauch, Mönchskutten und gesenktem Blick. Doch im Kern steckt in diesem Wort eine Kraft, die wir in unserer hypervernetzten, hyperbeschleunigten Welt dringender brauchen als je zuvor. Demut ist nicht Unterwürfigkeit, sie ist das Gegenteil von Selbstverleugnung. Sie ist die Haltung, die eigene Bedeutung realistisch zu sehen und trotzdem den Mut zu haben, sich einzubringen, ohne sich über andere zu erheben. In Zeiten, in denen Schlagzeilen, Social-Media-Likes und „Ich-zuerst“-Mentalität dominieren, wirkt Demut wie ein leiser, aber klarer Gegenentwurf.
Demut ist eine der Grundlagen unser aller Werte! Sie ist die Basis des Mindsets, welches es braucht, damit wir meschliches Zusammenleben optimal gestalten können.
Dass Wort Demut kommt aus dem althochdeutsch: diomuoti (belegt seit dem 8./9. Jh.). Spannend, mal nicht aus dem lateinischen oder griechischen.
Demut als Schutzschild
Jedes Gefühl, jeder Gedanke und jeder Hass sind Spiegel unserer eigenen Seelenverfassung. Demut wirkt hier wie ein kraftvoller Heiler. Sie ist eine Grundhaltung, auf der alle anderen Werte und vor allem der Schutz vor Hass, Neid, Missgunst und negativen Gedanken beruhen. Denn genau diese negativen Gedanken ziehen wiederum dieselbe Energie an. Das ist das Gesetz der Gleichheit, wie es die hermetischen Regeln beschreiben.
Im Kern ist das hermetische Resonanzgesetz eine Einladung, unser Bewusstsein zu klären. Anstatt an den Ästen der Welt herumzusägen und nur Symptome zu stutzen, setzen wir an der Wurzel an: bei uns selbst. Das ist kein Rückzug in eine esoterische Wolke, sondern ein zutiefst praktischer Ansatz. Jeder Mensch hat Macht über seine Gedanken, seine Sprache und seine innere Haltung und genau diese Macht entfaltet Wirkung. Sie wirkt wie ein Magnet, der Gleiches anzieht und Unvereinbares abstößt. Wer sein eigenes Feld ordnet, ordnet damit auch die Erfahrungen, die er in der Welt macht.
Zwischen Hochmut und Demut steht ein Drittes, dem das Leben gehört, und das ist der Mut.
Theodor Fontane
Demut mehr als Bescheidenheit
Viele setzen Demut mit Bescheidenheit gleich. Doch Bescheidenheit ist nur ein Aspekt ja, sogar eine Herabwürdigung dieses hohen Wertes. Demut bedeutet auch, offen für andere Perspektiven zu sein, Fehler eingestehen zu können, das eigene Wissen als begrenzt zu sehen und die eigene Meinung keinesfalls als die einzig richtige oder wahre zu bewerten. In der Zusammenarbeit ist das Gold wert: Wer demütig ist, hört zu, statt sofort zu urteilen. Er oder sie erkennt die Leistungen anderer an und braucht nicht ständig die Bühne. So entsteht ein Raum, in dem Vertrauen und Kreativität wachsen können, weil niemand Angst haben muss, bloßgestellt zu werden. In Bezug auf Demut kann ich Sokrates mit Begeisterung folgen, der diese Haltung in aller Deutlichkeit so beschrieb:
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Sokrates
Einfache Worte, die alles über Demut aussagen. Für uns Menschen ist es entscheidend, unser Wissen in Relation zum „Allwissen“ zu setzen. Erst dann, gepaart mit Bewusstsein, sind wir in der Lage, Demut, wirkliche Demut, zu entwickeln. Unser Wissen ist im Verhältnis zum Allwissen so klein, dass es sich nicht einmal mit einem Sandkorn im Universum vergleichen ließe. In dem Moment, in dem wir uns dessen bewusst werden, entsteht eine tiefe Demut, die es unmöglich macht, sich über andere Menschen zu erheben und Hochmut an den Tag zu legen.
Warum Demut so schwerfällt
Unsere derzeitige Kultur belohnt Lautstärke. Karriereleitern, Influencer-Erfolg, KPI-Dashboards alles scheint darauf ausgelegt zu sein, schneller, größer, sichtbarer zu werden. Demut passt da nicht ins Narrativ. Sie ist schwer messbar, bringt keine Quartalszahlen und kein Rampenlicht. Und dennoch: Teams und Gesellschaften, die ohne Demut handeln, rutschen in Zynismus, Misstrauen und Machtspiele ab. Das Ergebnis ist Burn-out und ein Klima der Angst. Kurz: Wir alle sehen dieses Resultat derzeit in unserem Land in Politik und Gesellschaft. An dieser Stelle ist unsere Generation Z zum Opfer unserer eigenen gesellschaftlichen Prägung geworden. Wir haben vermittelt, dass junge Menschen der Realität der vorherigen Generationen nur mit Ellbogen, Egoismus, Karriere und immer schnellerer sowie effizienterer Informationsübermittlung begegnen können. Nur wer noch digitaler ist als der Rest, wird Erfolg haben. Damit wir nicht mit dem Generationenvertrag kollidieren, der verspricht, dass die nächsten Generationen es besser und immer besser haben wird als die Eltern, müssen wir uns schneller und schneller drehen. Ich würde sagen: überdrehen. Dieses geforderte, antrainierte und vorgelebte Leben führt automatisch zu zunehmend fehlender Demut. Da Demut ein Grundwert ist, fehlen dann auch alle anderen Werte wie Respekt, Achtsamkeit, Bewusstsein, Vertrauen und Empathie.
Demut bedeutet für mich auch, sich im großen Gefüge unseres Universums, der Erde, der Gesellschaft und der Familie richtig einzuordnen. Sie heißt auch zu erkennen, dass jeder Einzelne nur ein winziges Stück eines riesigen Puzzles ist des Puzzles des Lebens. Keiner, ich betone: keiner, ist so wichtig und bedeutend, dass er das Recht hätte, sich über andere zu erheben. Doch jeder Mensch, der Demut lebt, wird unablässig bestrebt sein, durch „Verstehen“ und „Respekt“ seine für sich genommen eher begrenzte Wirkung zu vervielfachen.
In dem folgenden Blogbeitrag, der hier als Link zur Verfügung steht, habe ich mich mit einem der Folgewerte beschäftigt.
Ein neues Führungsverständnis
Gerade in der Arbeitswelt der Zukunft geprägt von Generation Z, hybriden Teams und KI-gestützten Prozessen wird Demut zur Schlüsselkompetenz. Führungskräfte, die sich als „Ermöglicher“ statt als „Bestimmer“ verstehen, schaffen Bindung und Sinn. Sie fragen: „Was braucht ihr?“ statt „Was bringt mir das?“ und hören wirklich hin. Demut bedeutet hier auch, die eigenen Grenzen zu akzeptieren: Niemand hat alle Antworten, schon gar nicht in komplexen Systemen. Wer demütig führt, holt sich Rat, lässt sich challengen und feiert die Erfolge des Teams nicht nur die eigenen. Wie oben beschrieben, haben wir einen Mangel an Demut; umso mehr steigt der Wert von Führungskräften, die Demut besitzen und in der Lage sind, sie zu kultivieren.
Hier ist die Aufgabe, die Challenge, die Herausforderung, wie schnell schaffen wir es, einen Wandel im Bewusstsein zu schaffen? Demut ist auch als ein Wirtschaftsfaktor zu sehen. Denn mangelnde Demut ist geschäftsschädigend und am Ende zwangsläufig gesellschaftsschädigend.
Demut im Alltag üben
Demut lässt sich trainieren ähnlich wie Achtsamkeit. Drei einfache Impulse, nur für den Anfang:
- Perspektivwechsel: Jeden Tag bewusst eine Situation aus der Sicht des anderen betrachten. Was treibt ihn oder sie an? Ich nenne es gern: In den Mokassins des anderen laufen. Die Frage lautet: Warum denkt, entscheidet oder handelt der Gegenüber so? Was hat ihn dazu veranlasst?
- Fehlerkultur leben: Eigene Fehler zuerst sehen und ansprechen um daraus zu lernen. Das senkt den Druck für alle beteiligten.
- Feedbackkultur in Form von Dankbarkeit praktizieren: Regelmäßig wertschätzen, was andere beitragen leise, ohne PR-Effekt. Ganz wichtig, auch negative Anspekte sehen und lösen. Die entscheidende Frage lautet: Was habe ich (Leader) unterlassen, damit dieser Fehler entstehen konnte?
Diese ersten kleinen Schritte schaffen ein Klima, in dem Zusammenarbeit leichter und menschlicher wird.
Beurteile nie einen Menschen, bevor du nicht mindestens einen halben Mond lang seine Mokassins getragen hast.
Indianische Weisheit
Demut ist Stärke
Manchmal, nein, sehr oft, wird Demut mit Schwäche verwechselt. In Wirklichkeit erfordert sie Mut. Es ist leichter, die Fassade des Allwissenden zu wahren, als offen zu sagen: „Das weiß ich nicht“ oder „Ich habe mich geirrt.“ Doch gerade diese Offenheit schafft Glaubwürdigkeit. Sie macht Menschen berechenbar und baut Vertrauen auf. In Teams bedeutet das: Konflikte werden konstruktiver gelöst, Innovationen haben eine echte Chance und die Motivation steigt, weil alle gesehen werden.
Gesellschaft als Lernraum
Auch jenseits des Arbeitsplatzes brauchen wir mehr Demut in Debatten, im Straßenverkehr, in der Nachbarschaft. Demut bedeutet, den anderen nicht als Gegner zu sehen, sondern als Mitmenschen. Sie verhindert, dass wir die Welt in Freund-Feind-Schemata aufspalten. Gerade in polarisierenden Zeiten ist das ein unschätzbarer Beitrag zum Zusammenleben.
Um das erreichen zu können, braucht es erwachsene Menschen, reife Persönlichkeiten, klare Denker und sensible Fühler. In Gesellschaft, Wirtschaft und Politik brauchen wir eine völlig neue Qualität von Menschen mit Demut, Respekt und der richtigen Mischung aus emotionaler und rationaler Intelligenz. Menschen, die Erfahrungen, Wissen und Einfühlungsvermögen so kombinieren, dass sie sich selbst und die Gesellschaft weiterentwickeln können.
Meine Formel dazu:
EQ+IQ+RF=Demut
Erklärung zu meiner persönlichen Formel:
Wer einen reifen emotionalen Intelligenzquotienten(EQ) besitzt und diesen mit rationaler Intelligenz(-quotient)(IQ) und Reflexionsvermögen(RF) kombiniert, wird fast automatisch demütig.
Fazit: Leiser, aber wirksamer
Demut ist kein Trend, den man wie ein neues Tool einführt. Sie ist eine Haltung (Mindset), die uns befähigt, das eigene Ego in den Dienst eines größeren Ganzen zu stellen des Teams, der Organisation, der Gemeinschaft. Wer demütig handelt, macht Platz für die Talente und Ideen anderer und sorgt dafür, dass Zusammenarbeit nicht zum Machtspiel, sondern zur gemeinsamen Reise wird. Wie ich schon einmal schrieb: Leadership ist, Freude dabei zu empfinden, wenn andere sich entwickeln. (frei nach Boris Grundl)
Ich bin der Auffassung, dass Demut einer der Grundwerte des Menschen ist ohne sie sind Respekt, Achtsamkeit usw. nicht möglich. Außerdem bin ich der Meinung, dass die vermeintlich fehlende Demut einen Großteil des Konflikts zwischen den Generationen, insbesondere mit Generation Z, ausmacht. Nur sollten wir wie oben beschrieben nicht vergessen, wer die Generation Z erzogen, begleitet und auf das Leben vorbereitet hat: Das waren wir! Wenn wir Demut nicht vermitteln können, dürfen wir auch nichts erwarten.
Beispiel: Noch vor 15–20 Jahren hatte das Wort von Oma und Opa gegenüber den Enkelkindern Gewicht und wurde geschätzt. Heute erleben wir, dass Eltern der Generation Z und Alpha den Großeltern teilweise sogar verbieten, vor den Kindern zu sprechen, weil ihre Stimme scheinbar keinen Wert mehr hat. Die Demut ist also nicht bei Generation Z oder Alpha verloren gegangen, sondern bei der Generation davor, bei denen, die diese Fehlentwicklung weitergegeben haben.
Vielleicht ist es an der Zeit, Demut neu zu entdecken nicht als Pflichtübung, sondern als strategischen Vorteil für gesünderes Arbeiten, vertrauensvolleres Zusammenleben und eine Kultur, die mehr auf Miteinander als auf Gegeneinander setzt.
Demut ist eigentlich nichts anderes als eine Vergleichung seines Wertes mit der moralischen Vollkommenheit.
Immanuel Kant
Denksportfrage:
An welcher Stelle sind die Generationen vor GenZ falsch abgebogen? Wann haben wir die Demut verloren, die wir dann auch nicht mehr weitergeben konnten?